Wenn die Opferrolle zur Identität wird
– und was wirklich hilft.
In den letzten Artikeln ging es um alte Muster, um Compliance und um Scham als das Gefühl, das Lernen verhindert.
Während ich mich tiefer mit genau diesen Themen beschäftigt habe, bin ich immer wieder an etwas angestoßen, das ich seit Jahren lehre und das auch fester Bestandteil meiner Ausbildung ist: die Dynamik und das Drama von Opfer, Retter und Täter.
Und je länger ich hinschaue, desto klarer wird mir, wie massiv diese Rollen wirken . als Identität.
Als etwas, das Menschen über Jahrzehnte stabil hält – selbst dann, wenn sie leiden.
Die Opferrolle ist kein Etikett, sondern ein Überlebensmuster
Wenn wir von der Opferrolle sprechen, geht es nicht um Schwäche, Unreife oder mangelnden Willen.
Psychologisch betrachtet handelt es sich um eine hochwirksame Anpassungsleistung, die meist sehr früh entsteht.
In Umfeldern, in denen eigene Bedürfnisse wenig Raum hatten, emotionale Sicherheit fehlte oder Verantwortung zu früh abgegeben werden musste, lernt das Nervensystem sehr klare Zusammenhänge. Und zwar weniger in den Gedanken, sondern als Körperwissen gespeichert.
Klarheit fühlt sich gefährlich an, Sichtbarkeit entsteht über Leid, Nähe entsteht über Hilfsbedürftigkeit, Verlust kommt durch loslassen,
echte Verantwortung wird vermieden, um Bindung nicht zu verlieren. Und und und …
Diese Logik läuft nicht bewusst ab. Sie ist tief im Körpergedächtnis gespeichert und bestimmt, wie jemand Beziehungen eingeht, Konflikte erlebt und auf Grenzen reagiert.
Das Drama Dreieck und die Opferrolle: Warum Beziehungen sich immer wieder gleich anfühlen
Ein zentrales Modell, um diese Dynamiken zu verstehen, ist das Drama Dreieck nach Stephen Karpman.
Es beschreibt drei Rollen, die in konflikthaften Beziehungen unbewusst eingenommen werden und sich gegenseitig stabilisieren: Opfer, Retter und Täter.
Das Opfer fühlt sich ohnmächtig und wartet auf Erlösung von außen.
Der Retter hilft, erklärt, tröstet und übernimmt Verantwortung.
Der Täter setzt Grenzen hart, wertet ab oder zieht sich kühl zurück.
Wichtig ist: Niemand ist dauerhaft eine dieser Rollen.
Die Positionen wechseln, oft unbemerkt, manchmal innerhalb eines einzigen Gesprächs.
Das Entscheidende ist etwas anderes: Solange alle drei Rollen besetzt sind, bleibt das System stabil.
Es entsteht Bewegung, aber keine Veränderung.
Und genau deshalb sind Einsicht, Gespräche oder gute Vorsätze allein meist wirkungslos.
Warum der Ausstieg sich wie ein Identitätsverlust anfühlt
Aus der Opferrolle auszusteigen bedeutet nicht einfach, Verantwortung zu übernehmen.
Es bedeutet, sich innerlich von etwas zu lösen, das über Jahre Sicherheit gegeben hat.
Viele Menschen stoßen dabei auf Gefühle, die kaum auszuhalten sind: Schuld, Scham, Trauer und eine tiefe Verunsicherung.
Nicht selten taucht die Frage auf: Wer bin ich ohne dieses Leid?
Neurobiologisch ist das gut erklärbar. Das Nervensystem ist auf Sicherheit im Bekannten ausgerichtet.
Selbst leidvolle Muster können sich stabiler anfühlen als das Risiko von Veränderung.
Studien zur erlernten Hilflosigkeit zeigen, dass Menschen nach wiederholter Ohnmacht selbst dann keinen Handlungsspielraum mehr nutzen, wenn er objektiv vorhanden wäre.
Je länger ein Muster besteht, desto höher wird der innere Preis für den Ausstieg aus der Opferrolle.
Scham als Klebstoff der Rolle
Hier schließt sich der Kreis zu den vorherigen Artikeln. Scham ist oft der unsichtbare Faktor, der die Opferrolle zusammenhält.
Scham verhindert Lernen. Sie verhindert Selbstwirksamkeit. Sie verhindert, dass Verantwortung nicht als Bedrohung erlebt wird.
Solange Scham aktiv ist, bleibt der Körper im Schutzmodus. Man versteht vielleicht, was passiert.
Man kann es vielleicht sogar benennen. Aber man kann es nicht verändern.
Und genau deshalb bleibt man lieber im Bekannten, selbst wenn es schmerzt.
Warum Mitgefühl allein nicht hilft
Ein häufiger Irrtum ist die Annahme, dass mehr Verständnis, Nähe oder Geduld automatisch heilsam sind.
In der Praxis bewirken diese Reaktionen jedoch oft das Gegenteil.
Sie puffern die Konsequenzen ab und sie stabilisieren die Opferrolle sogar!
Sie verlängern das Drama Dreieck.
Das bedeutet nicht, dass Mitgefühl falsch ist, aber Mitgefühl ohne Grenze wird schnell zu einer stillen Form der Komplizenschaft.
Was wirklich hilft – und was nicht
Hilfreich sind keine großen Erklärungen oder emotionalen Appelle, sondern sehr klare Rahmenbedingungen.
Grenzen ohne emotionale Kompensation, Kontakt ohne Verschmelzung, Spiegel ohne Rettung.
Zeit und Leere, in der kein Drama mehr bedient wird.
Nicht hilfreich sind dagegen ständiges Erklären, Trösten plus Handeln, Sonderbehandlungen oder Hoffnung ohne echte Veränderungsbereitschaft.
Warum Therapie oft unverzichtbar ist
Opfermuster und Opferrollen sind selten rein im Verstand, im Gegenteil.
Sie zeigen sich im Nervensystem als Freeze, Fawn, Kollaps oder chronische Hilflosigkeit.
Deshalb ist Therapie kein Zusatz, sondern die Voraussetzung für echte Veränderung.
Eine gute, traumasensible Therapie steigt nicht ins Drama Dreieck ein, hält Schuld und Scham aus und fördert Selbstwirksamkeit statt Abhängigkeit.
Ohne diesen Rahmen bleibt Veränderung oft oberflächlich oder instabil.
Eine unbequeme Wahrheit
Nicht jeder Mensch will oder kann aus der Opferrolle aussteigen. Für manche ist sie über Jahrzehnte identitätsstiftend geworden.
Heilung würde bedeuten, alles Bekannte zu verlieren.
Das ist keine moralische Schwäche, aber es ist eine Realität, die anerkannt werden muss.
Der eigentliche Perspektivwechsel
Menschen können andere verstehen, ohne sie zu retten.
Sie können Mitgefühl haben, ohne Verantwortung zu übernehmen.
Und sie dürfen gehen, ohne kalt zu sein.
Manchmal ist das Heilsamste, dem Drama die Bühne zu entziehen.
Was denkst du? Schreibe es mir direkt gerne per PN/ Mail oder Whatsapp. Und teile den Artikel gerne
Deine Simone
PS. Du möchtest gerne mal mit mir sprechen? Dann melde dich gerne zu einem kostenlosen Gespräch.

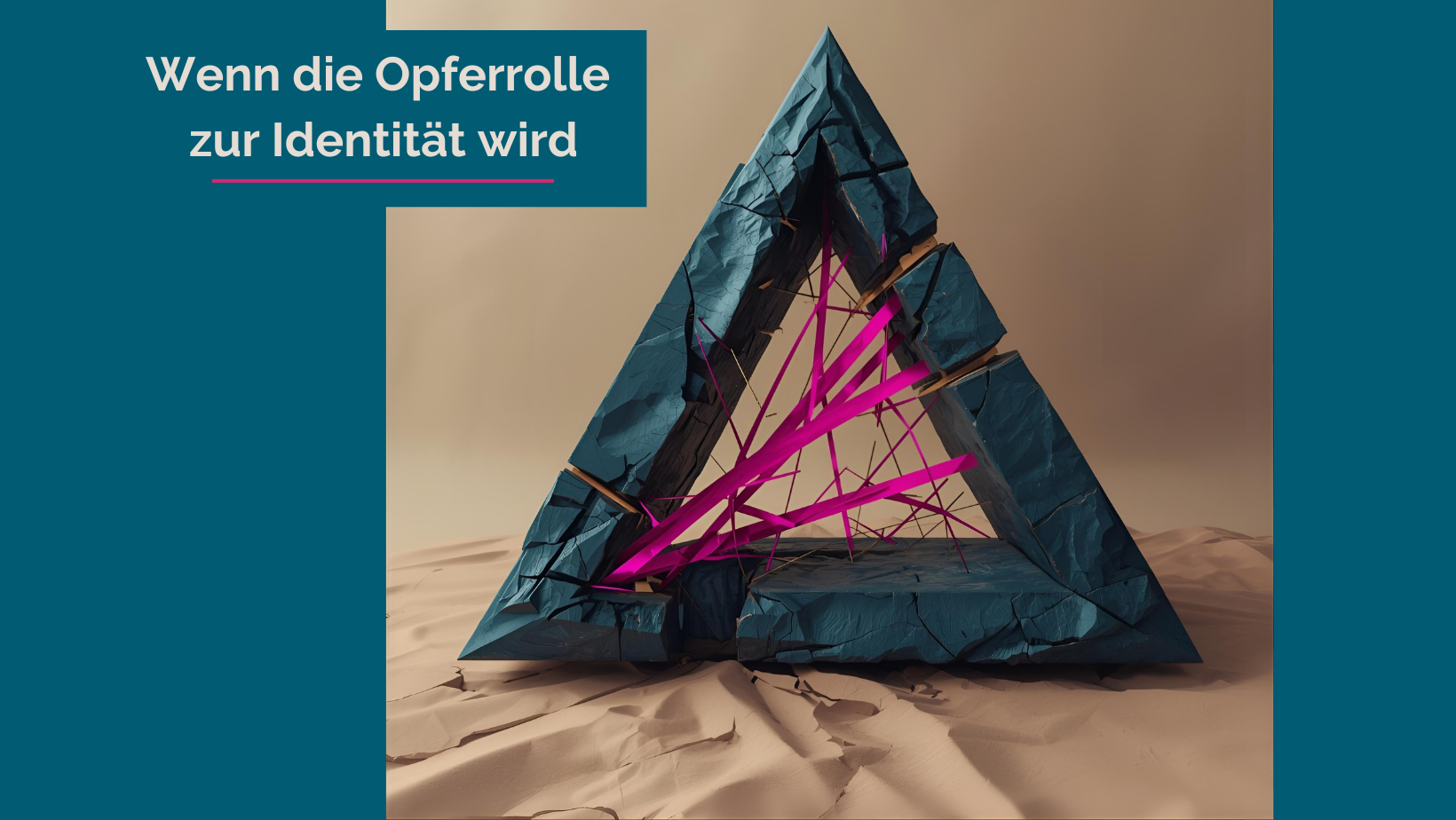













0 Kommentare